100 Jahre Schule im St. Josef-Stift



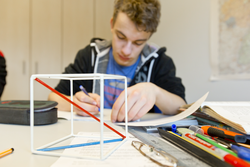
Ein Stück normalen Alltag – das und viel mehr ermöglicht die Klinikschule im St. Josef-Stift bereits seit einem Jahrhundert. Die Bildungseinrichtung konnte den ehemaligen Namen „Schule für Kranke“ aus einem inklusiven Ansatz heraus ändern, und stellt darüber hinaus die Inklusion und sozial-emotionale Entwicklung ihrer Schüler in den Mittelpunkt. Vor 100 Jahren lief das etwas anders.
Jahrelange Krankenhausaufenthalte
Angefangen hat alles in den 1920er Jahren: Unter dem damaligen geistlichen Leiter Dr. Dr. Eduard Goossens übernimmt das St. Josef-Stift als Heilstättenbetrieb die Behandlung von Knochentuberkulose und Knochenbildungsstörungen, welche aufgrund der hohen Infektionszahlen vom Staat finanziert wurde. Die stationär zu behandelnden Patienten und Patientinnen waren zu dieser Zeit vor allem Menschen aus ländlichen Verhältnissen; auch Kinder. Erkrankten bekamen eine kalorienreiche Ernährung, außerdem gab es Luft- und Sonnenbäder. Bewegung war aufgrund der Krankheiten meist nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Bis zur Heilung verstrichen oft mehrere Jahre, und nur etwa die Hälfte der jungen Patienten konnte die Einrichtung innerhalb eines Jahres wieder verlassen.
Die vornehmlich lange Verweildauer der oft auch jungen Patienten von teilweise bis zu acht Jahren veranlasste Goossens in jener Zeit dazu, eine Klinikschule im St. Josef-Stift zu eröffnen. Als staatlich anerkannte private Volksschule sollte die „Schule für Kranke“, wie sie damals noch hieß, die allgemeine Bildung der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen sichern und ermöglichte ihnen sogar einen schulischen Abschluss. Finanziert wurde die Schule bis 1952 von der Klinik selbst, bis die Stadt Sendenhorst die Trägerschaft übernahm.
Unterricht mal anders
In zwei Gruppen mit den Klassen eins bis vier und fünf bis acht unterrichteten Frau Becker und Frau Backers die Mädchen und Jungen jeweils getrennt nach Geschlecht. Die Schülerinnen und Schüler lernten in den großen, lichtdurchfluteten Liegehallen und den weitläufigen nach Süden gerichteten Balkons aus dem Bett heraus durch den Einsatz von Schiebetafeln das Lesen, Schreiben und Rechnen. Auch Heimat- und Naturkunde so wie Religion wurden gelehrt. Dieses Konzept brachte den Namen der „Bettenschule“ mit sich. Die älteren Jugendlichen lasen den Jüngeren oft vor und halfen ihnen beim Lernen. Das sorgte auch für sozialen Kontakt untereinander. Besuch erhielten die meisten jungen Patientinnen und Patienten eher selten, weil kaum jemand ein Auto besaß und vielen Eltern oft die Zeit für eine weite Reise fehlte.
Neue Ansätze und neue Räumlichkeiten
Mit der Zeit erkannte man den Infektionsweg der Knochentuberkulose, sich anzustecken konnte vermieden werden und Antibiotika beschleunigten den Genesungsprozess. Die Heilstätte wurde damit überflüssig und aufgelöst. Doch eine Neuausrichtung Ende der 1950er Jahre hin zu einer orthopädischen Fachklinik brachte dem Sendenhorster Krankenhaus und auch seiner Klinikschule neuen Aufschwung.
Mit dem Neubau der Schulstationen Schönblick für die Mädchen, und Tannenhof für die Jungen Anfang der 1960er Jahre war es den Schülern möglich, für bestimmte Fächer auch gemeinsam zu lernen. Die Zahl der schulpflichtigen Patienten stieg weiter an, weshalb mehr Lehrkräfte eingestellt wurden. Herr Titz übernahm 1964 die Leitung der Schule als Nachfolger von Frau Becker. Mit dem medizinischen Fortschritt veränderten sich die Behandlungszeiten auch in der Orthopädie hin zu einer kürzeren Aufenthaltsdauer der Patienten. Ende der 1970er Jahre lag diese bei nur noch 50 Tagen, was auch mit einer deutlich geringeren Auslastung der Schule einher ging – Tendenz weiter fallend.
Die Rheumatologie wurde 1980 zusätzlich zur Orthopädie als weiterer Fachbereich eingeführt. In dem Zuge eröffnete Dr. Gerd Ganser im Jahr 1989 die Klinik für Kinder- und Jugendrheumatologie am St. Josef-Stift. Die Stiftschule gewann damit wieder an Bedeutung und die Unterrichtsorganisation änderte sich grundlegend. Weil die Kinder und Jugendlichen zwar noch wochenlang behandelt, aber immer mobiler wurden, entfiel das Bettenschieben in den Liegesälen. Der damalige Schulleiter Norbert Herberhold und sein Team erhielten eigene Unterrichtsräume, in denen sie von den Schülern aufgesucht wurden.
2005 sind die Schulstationen dem Parkflügel gewichen. Im Sockelgeschoss befindet sich nun ein eigener Bereich für die Schule. Auf der gleichen Etage sitzen die therapiebegleitenden Psychologen und das Familienbüro des Bundesverbandes Kinderrheuma. Bis heute hat sich das Prinzip der lehrereigenen Unterrichtsräume gehalten, nur in seltenen Fällen gibt es noch den Unterricht am Bett.
Die Krankheit raus aus dem Mittelpunkt
Mittlerweile werden jährlich bis zu 500 Schüler mit rheumatischen Grunderkrankungen und chronischen Schmerzen in der Klinikschule betreut. Peter Heidenreich ist seit 2013 Schulleiter der Schule im St. Josef-Stift und betont: „Der Unterricht ist nicht nur dazu da, um den Anschluss in der Heimatschule zu sichern. Die Krankheit der Kinder rückt aus dem Mittelpunkt. Gleichzeitig lernen die Schüler auch in diesem Kontext mit ihrer Krankheit umzugehen und eine eigene Haltung zu entwickeln“. Der psychosoziale Aspekt hat durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Pflegenden, Lehrkräften, Ärzten, Psychologen, Therapeuten und Sozialarbeitern deutlich an Relevanz gewonnen und wird auch in dem individuellen Therapieplan der schulpflichtigen Patienten berücksichtigt. Dort eingegliedert sind die meist halbstündigen Unterrichtseinheiten der Fächer Deutsch, Englisch, Mathe, Französisch und Latein. Die Mitarbeitenden der Schule im St. Josef-Stift pflegen während des Aufenthalts der Patienten engen Kontakt mit der Heimatschule, um über einen möglichen Nachteilsausgleich, den Unterrichtsfortschritt oder alternative Leistungserfassung zu informieren.
Heutzutage ist die stationäre Behandlungszeit auf einige Tage bis wenige Wochen gesunken. Die Klinikschule ermöglicht weiterhin eine möglichst gute Wiedereingliederung in den Unterricht an den Heimatschulen und fördert aktiv die Selbstorganisation und Selbstwirksamkeit der Schüler. Die verschiedenen Kooperationspartner unterstützen die Schüler nicht nur in bildungstechnischen, sondern auch medizinischen und psychischen Belangen und leisten damit einen wichtigen Beitrag für den Genesungsprozess.
